Wir kommen mit vier grundlegenden Emotionen auf die Welt: Freude, Wut, Trauer und Angst. Jede spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Menschen.
Alle im Beitrag beschriebenen Emotionen im Überblick
Freude

Der natürliche Zustand des Menschen.
Rolle: Die Freude ist die Motivation zum Leben und sich zu entwickeln.
- Beste Ressource zum Lernen: In einem Zustand von Freude wird schneller und effizienter gelernt als etwa unter Zwang und Angst.
- Notwendig für die physische Gesundheit: bessere Wundheilung, stärkeres Immunsystem, längere Lebenserwartung.
Bedürfnis: Da es der natürliche Zustand des Menschen ist, gibt es nur das Bedürfnis, immer wieder in diesen Zustand zu finden. Denn in diesem Zustand ist der Körper am stärksten und kann am besten wachsen, heilen und gedeihen.
Wut

Eine heftige Emotion, die oft impulsiv und im Affekt ausbricht.
Rolle: Mit Wut werden die eigenen Grenzen durchgesetzt und Eindringlinge verjagt. Die ersten Zeichen von Ärger sind ein Signal, dass etwas oder jemand unser Territorium bedroht.
- Je präziser und näher die Bedrohung, desto grösser die Wut.
- Die Explosion von Wut garantiert das Verdrängen von Eindringlingen aus unserer persönlichen Komfortzone.
- Es ist immer wichtig, die Gründe der Wut in sich selbst zu suchen und nicht ausserhalb bei anderen Menschen.
Bedürfnis: Hinter der Wut steckt oft das Bedürfnis respektiert zu werden.
Es gibt verschiedene Arten von Wut.
So sehen etwa „Colère“ und „Rage“ ähnlich aus, aber der Mechanismus dahinter ist ein anderer.
Bei „Colère“ wurden unsere Grenzen überschritten. Um unser Territorium wieder einzunehmen respektive die Eindringlinge zu verjagen, explodiert unser innerer Vulkan.
Bei „Rage“ handelt es sich um eine intensive Frustration respektive einer intensiven Machtlosigkeit, bei welcher wir versuchen die Grenzen von anderen Leute zu zerstören. Es zeigt sich oft in Form von Vorwürfen.
Trauer
Eine Emotion, die oft durch einen Verlust (jemand oder etwas) ausgelöst wird.
Rolle: Trauer nützt dem Menschen, um wieder für etwas Neues verfügbar zu sein.
Sie bereitet uns auf eine neue Situation vor, indem sie uns dazu bringt, eine Phase loszulassen und abzuschliessen, bevor etwas Neues anfangen kann.
Bedürfnis: Getröstet zu werden.
Angst

Ein Gefühl der Beklemmung und Besorgnis, meistens ausgehend von etwas Unbekanntem.
Rolle: Die Wahrnehmung kommender Umstände, die man mit Vorsicht angehen muss.
Entweder besteht eine objektive Gefahr oder die Situation ist neu und unbekannt. Neues und unbekanntes löst vielfach Angst aus, nur sind wir uns dies selten bewusst.
- Es ist normal, Befürchtungen gegenüber neuen Situationen zu haben.
- Die Angst ist ein nützliches Signal dafür sich besser zu informieren. Denn: Je besser wird informiert sind, desto weniger Angst haben wir.
- Umgekehrt ist es genauso: Habe ich Angst, bin ich zu wenig informiert.
- Ist die Angst vorherrschend, will man flüchten und sich distanzieren; oder man „friert ein“.
Bedürfnis: Beschützt zu werden/sein.
Wichtig fürs Leben
Alle diese vier Emotionen haben verschiedene Intensitäten. Von einfacher Zufriedenheit zu jauchzender Euphorie, von leichtem Ärger zu rasender Wut, von bedrückender Melancholie zu tiefstem Kummer, von leichter Sorge zu panischer Angst – und allem, was dazwischenliegt.
Diese Emotionen sind wichtige Indikatoren, die uns in unserem täglichen Leben leiten.
Verzerrung durch Gesellschaft
Leider entsteht bereits in sehr jungen Jahren der soziale Druck, sei das durch Gesellschaft oder Familie, seine Art von Gespür und Ausdruck adaptieren und modifizieren zu müssen. Bei Kindern wird der natürliche Ausdruck dieser vier Emotionen verzerrt und unterdrückt. Sie werden so wichtiger Referenzpunkte beraubt.
Gleichzeitig werden die Kinder neue Emotionen lernen: Scham (wie in unserem Beispiel etwa), Schuld, Frustration, Eifersucht, Neid, Mitleid und so weiter.
Dies sind alles Gefühle, die mit Sozialisierung eng verknüpft sind und vielfach auf unangemessene und unbeholfene Art und Weise entstehen, meistens ohne das Alter und die Reife eines Kindes zu berücksichtigen. Dies sind keine natürlichen Emotionen.
Statt Scham und Schuld gegenüber seinem Verhalten zu fühlen, lernt das Kind Scham und Schuld gegenüber seinen emotionalen Gefühlen. Das bleibt dem Kind natürlich auch als Erwachsener.
Scham
Definition nach Brené Brown: „Das unangenehme Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und deswegen keine Liebe zu verdienen.“
Die Scham ist nötig, um sich der gesellschaftlichen Norm zu unterwerfen. Man entwickelt dabei eine Sensibilität dafür, die „Blicke“ seiner Mitmenschen zu erkennen und zu deuten und somit sich deren Beurteilung auszusetzen.
Schuld
Ein Signal, dass man eine verbotene oder moralische Grenze überschritten hat und die Feststellung, dass man jemandem geschadet hat.
Scham und Schuld sind höchst unangenehme, stechende Emotionen. Um sich selbst zu schützen, entscheiden wir uns (meistens) diese zu vermeiden oder zu ignorieren, statt die abweichenden und defekten Verhalten anzugehen.
Die Unterdrückung von Emotionen
Die teilt die Emotionen in zwei Kategorien auf.
Die verbotene Emotion
- Muss versteckt und unterdrückt werden
- Wird gelagert. Jede unterdrückte Emotion, seit Kindheit, wird gelagert. Dieser Container ist leider nicht unendlich.
- Ängste zum Beispiel können gelagerte verbotene Emotionen sein, die drohen herauszukommen, wenn der Container zu voll wird. Zum Beispiel, wenn ein Kind mitteilt, dass es Angst vor dem Monster hinter dem Vorhang hat und die Eltern antworten „es gibt kein Monster, also musst du auch nicht Angst haben.“ Diese Angst wird automatisch in den Container der verbotenen Emotionen gelagert und gegebenenfalls später zu einer anderen Emotion umgewandelt.
Die erlaubte Emotion
- Darf genutzt werden, aber auf eine kalkulierte und manipulative Art und Weise.
Diese „falsche“ Art und Weise zu funktionieren, hat verschiedene Konsequenzen.
Bei den erlaubten Emotionen
- Parasiten Emotionen. Um Scham und Schuld zu vermeiden, werden diese „gelagert“ und durch eine Emotion getauscht, die in unserer Gesellschaft besser toleriert wird.
- Etwa weinen statt schreien: weinen wird getröstet und schreien wird bestraft, was uns meistens lieber ist → einer der Ursprünge des Drama-Dreiecks.
- Mit der Zeit und bei Wiederholen dieser Reaktionen lernt das Kind, den Kontakt zu seinen verbotenen Emotionen zu verlieren und somit die Aufmerksamkeit zu erlangen, die es braucht, um zu überleben.
- Emotionale Erpressung. Das Kind merkt, was die Konsequenzen seines emotionalen Ausdruckes sind und wird übertreiben, um seine Umgebung zu manipulieren → ein anderer Ursprung des Drama-Dreiecks.
- Eine wütende Person wird mit ihrem Wutausbruch „Autorität/Macht“ auf ihre Umgebung ausüben können. Denn Wutausbrüche können Angst im Gegenüber auslösen und eine verängstigte Person kann einfacher manipuliert werden.
- Eine depressive Person wird ihre Tränen nützen, um unangenehme Diskussionen zu vermeiden.
- Schmollen (Entbehrung von Freude) zählt auch zu emotionaler Erpressung.
Bei den verbotenen Emotionen
Die sind meistens sehr geschlechtsabhängig. Frauen lernen früh, dass Wut keine feminine Emotion ist und somit nicht erlaubt oder erwünscht ist. Männer gelten dann als männlich, wenn sie Gleichgültigkeit oder Wut ausdrücken können. Alle anderen Emotionen werden als „schwach“ empfunden.
Diese verbotenen Emotionen werden dann durch erlaubte Emotionen ersetzt und ausgedrückt. Wut bei einem Mann kann ein Versuch sein, Traurigkeit auszudrücken. Tränen bei einer Frau hingegen können ein Zeichen von unterdrückter Wut sein. Diese verbotenen Emotionen triggern verschiedene „Anti-Emotionen“, um die verbotenen zu vermeiden, meistens weil man selbst nicht weiss, wie damit umzugehen.
- Scham: „Jungs/Männer weinen nicht.“
- Verweigerung: „Es gibt doch kein Grund traurig zu sein.“ „Hör auf mit dem Theater.“
- Schuld: „Es macht mich krank, dich so zu sehen.“
- Angst: „Hör auf zu rennen, sonst ärgere ich mich!“
- Trost: „Beruhige dich, Mami kauft dir ein Eis.“
Man kann unbewusst auch lernen, der Emotion eine andere Bedeutung zu geben. Zum Beispiel wenn man wütend wird, weil man müde ist. Als Erwachsener wird man jedes Mal müde sein, wenn diese Emotion hochkommt.
Frustration

Eine der unangenehmsten Emotionen.
Woher kommt sie?
Aus der kindlichen Illusion, dass sich das ganze Universum um einen dreht.
Früher oder später wird das Kind mit der Realität konfrontiert. Es ist deswegen wichtig, dass Kinder den Unterschied zwischen Traum und Realität lernen.
Der Verlust dieser Illusion und das „an seine Grenzen stossen“ ist schmerzhaft und löst das Gefühl von Machtlosigkeit aus. Dies kann zur Frustration führen.
Frustration ist schmerzhaft, aber nötig. Die Machtlosigkeit ist für unser mentales Gleichgewicht wichtig: Du erinnerst dich etwa an das Gefühl von Angst, weiter oben? Ängste und Unsicherheit entspringen an einem Mangel der Kenntnis seiner eigenen Grenzen, das heisst, der Grenze seiner eigenen Identität.
Die Verwaltung der Frustration
Das Wort „Nein“! Und das ohne schlechtes Gewissen. Kinder brauchen einen Rahmen und Grenzen, um sich sicher zu fühlen. Erwachsene müssen ihnen diese Klarheit vorleben, dies muss konsequent passieren.
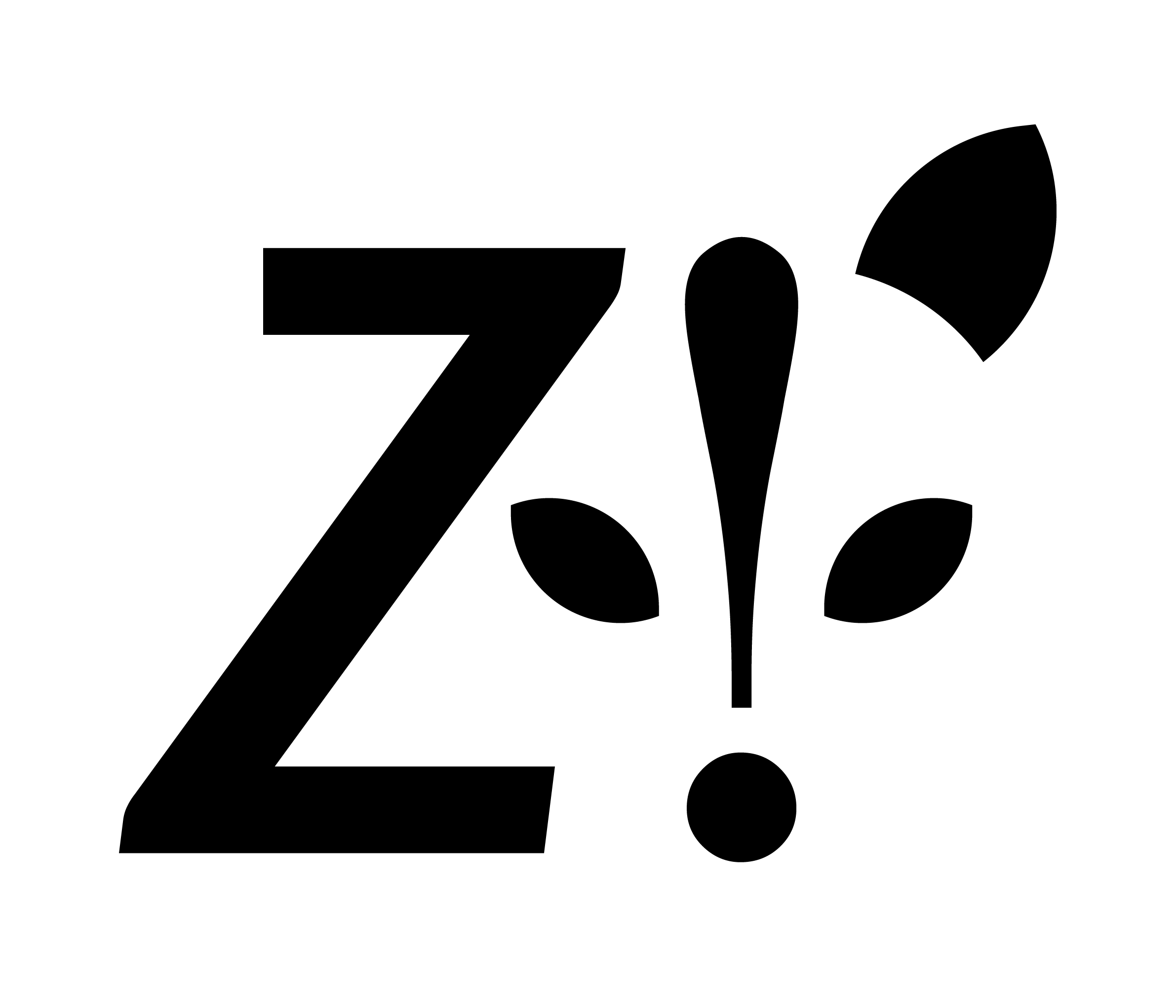




GIPHY App Key not set. Please check settings